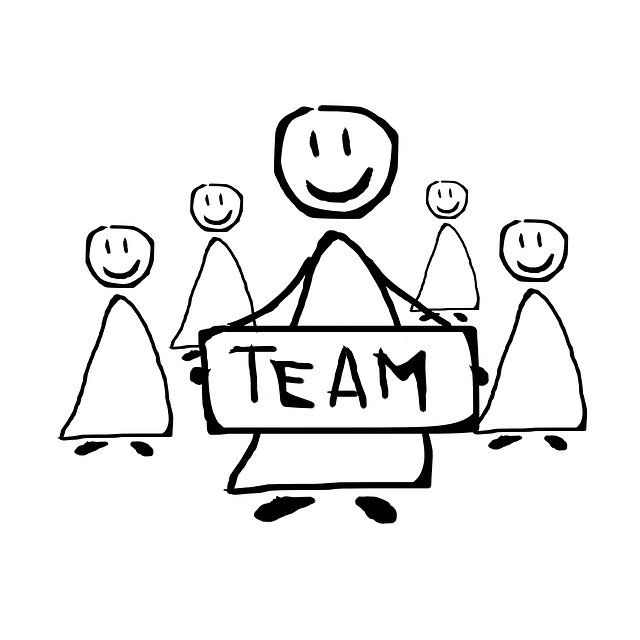Stress kennt jeder. Doch wenn er zu viel wird – dauerhaft, intensiv oder bedrohlich – brauchen wir innere Schutzmechanismen. Die Atmung hilft hier ganz gezielt. Als Atemexpertin zeige ich die besten Übungen.
Diese inneren Strategien wirken meist im Hintergrund. Doch je besser wir sie kennen, desto bewusster können wir sie steuern – statt ihnen ausgeliefert zu sein.
Was sind eigentlich Abwehrmechanismen – und warum sollte ich sie verstehen?
Abwehrmechanismen sind psychische Reaktionen, die uns helfen, mit belastenden Gefühlen umzugehen. Oft laufen sie automatisch ab. Sie halten Angst, Scham oder Trauer auf Abstand – und ermöglichen es uns, handlungsfähig zu bleiben.
Zum Beispiel: Jemand verletzt uns mit einem abwertenden Kommentar. Anstatt zu zeigen, wie weh es tut, machen wir einen Witz darüber. So schützen wir uns – zumindest kurzfristig – vor der vollen Wucht der Emotion.
Was bringt es, das zu wissen?
Wenn du verstehst, wie du dich schützt, kannst du besser einschätzen, ob diese Strategie dir wirklich guttut – oder ob sie langfristig mehr Probleme verursacht als löst. Und du kannst anfangen, neue Wege zu entwickeln, um mit Stress umzugehen.
Das IFS-Modell: Wenn unsere Schutzanteile eigene Stimmen haben
Ein besonders alltagsnahes Modell ist das Internal Family Systems Model (IFS). Es geht davon aus, dass unsere Psyche aus verschiedenen Anteilen besteht – ähnlich wie eine innere Familie. Und manche dieser Anteile übernehmen die Rolle von Beschützern.
Unsere Beschützer meinen es gut mit uns. Sie wollen uns vor Schmerz oder Überforderung schützen. Sie tauchen auf als Selbstkritik, als Rückzug, und gerne als Kontrollbedürfnis. Denn was ich kontrollieren kann, wird mich nicht verletzen.
Ein Beispiel aus dem Alltag: Du wirst im Job für eine Idee kritisiert. Sofort fährt in dir ein scharfer innerer Kritiker hoch: „Das war ja klar, du bist einfach nicht gut genug.“
Klingt hart, oder? Aber dieser Kritiker will vielleicht verhindern, dass du wieder verletzt wirst, indem er dich selbst zuerst kritisiert, bevor es jemand anders tun kann.
Warum ist es wichtig, die Innenwelt besser zu verstehen?
Weil du so nicht mehr denkst: „Mit mir stimmt etwas nicht“, sondern erkennst: „Aha, da ist ein Teil in mir, der schützen will.“
Das öffnet den Weg zu mehr Klarheit über uns selbst. Durch die Klarheit kann Selbstmitgefühl – und zu echten Alternativen im Verhalten.
Was tun, wenn der Schutz zur Last wird?
Manche Schutzmechanismen helfen uns, andere blockieren uns. Wut z. B. kann schützen, wenn wir angegriffen werden. Aber wenn wir ständig explodieren, werden die Beziehungen zu Freunden und der Familie geschädigt. Rückzug kann hilfreich sein, wenn wir Zeit brauchen. Aber Rückzug isoliert uns, wenn er zur Gewohnheit wird.
Stress entsteht also, weil unsere Schutzanteile so stark geworden sind, dass wir die anderen Seiten unserer Persönlichkeit nicht mehr spüren . Manchmal im Leben entsteht ein innerer Konflikt zwischen 2 Persönlichkeitsanteilen in uns. Da sie aber frisch mit einer chronischen KRankheit diuagnostiziert war, merkte sie, dass sie sich einfach oft selbst unter Strom setzt. So sagt der Kontrolleur dieser Klientin in einer SItzung: Ich kann mich nicht entspannen, nur wenn einer das Wort Entspannung sagt, dann sehr ich rot. Im GEspräch entdeckte Sie dann, dass der Kontrolleur sie einerseits vor Stress schützen will, dass aber seit Ihrer Erkrankung so viel Kontrolle die Krankheitssymptome verstärkte. Gemeinsam überlegten wir: Was willst der Kontrolleur mir sagen? Was brauchst der Kontrolleur eigentlich?
Das war der Moment, wo Veränderung möglich wurde und die KLientin in eine Atemübung einsteigen konnte.
Wenn wir unseren inneren Beschützern zuhören, können wir lernen unsere Lebens-Strategien anzupassenan die aktuellen Situationen. Der Kontrolleur blieb ein wichtiger Teil ihre Systems. Aber sie lernte, sich und ihr Leben flexibler und gesünder zu kontrollieren.
Was bedeutet das für den Alltag?
Wer lernt, sich selbst besser zu regulieren – gerade in schwierigen Momenten. Das kann Konflikte entschärfen, Beziehungen verbessern und langfristig deine psychische Widerstandskraft stärken.
Wie gehen andere Therapierichtungen mit Schutzmechanismen um?
Auch andere Therapien arbeiten mit diesen inneren Prozessen – nur unter anderen Begriffen und mit anderen Schwerpunkten:
1. Psychoanalyse und psychodynamische Therapie
Diese Ansätze gehen davon aus, dass Abwehrmechanismen unbewusst sind und meist in der Kindheit entstanden sind. Ziel ist es, sie ins Bewusstsein zu holen – also zu verstehen, warum wir z. B. verdrängen oder projizieren.
Für dich bedeutet das: Wenn du dein Verhalten verstehst, kannst du dich freier entscheiden – statt automatisch zu reagieren.
2. Verhaltenstherapie
Hier liegt der Fokus auf konkretem Verhalten. Schutzmechanismen wie Vermeidung, Grübeln oder Rückzug gelten als „erlernte“ Reaktionen auf Stress. Verhaltenstherapie hilft dabei, diese Muster zu erkennen – und durch neue, hilfreichere Verhaltensweisen zu ersetzen.
Was bringt’s dir?
Du lernst, wie du Schritt für Schritt neue Wege im Umgang mit Angst, Stress oder Druck einübst – praktisch, im Alltag umsetzbar.
3. Humanistische und integrative Therapieansätze
Hier geht es vor allem um Akzeptanz. Abwehrmechanismen werden nicht „wegtherapiert“, sondern in einem sicheren Rahmen behutsam angeschaut. Der Klient wird eingeladen, sich selbst mit Offenheit zu begegnen – auch den Teilen, die bisher unterdrückt wurden.
Das kann hilfreich sein, wenn du spürst:
„Da ist etwas in mir, das ich noch nicht ganz verstehe – aber ich will es nicht länger verdrängen.“
4. Populäre Selbsthilfe: Wut rauslassen – hilft das?
Oft hört man: „Wut muss raus – sonst frisst sie dich auf.“ Das klingt logisch. Doch Studien zeigen: Wer seine Wut regelmäßig „auslebt“ (z. B. mit einem Boxsack), baut sie nicht zwangsläufig ab – im Gegenteil, sie kann sich sogar verstärken.
Was bringt wirklich Entlastung?
Verstehen, was hinter der Wut steckt. Was genau dich verletzt oder überfordert hat. Und dann überlegen, wie du dieses Bedürfnis anders ausdrücken kannst – ohne dich selbst oder andere zu beschädigen.
Fazit: Schutz ist keine Schwäche – sondern Intelligenz
Unser Nervensystem entwickelt Schutzmechanismen, weil sie uns helfen will. Manchmal funktionieren sie – manchmal nicht. Doch wenn wir sie erkennen und verstehen, gewinnen wir Handlungsspielraum.
Was hast du davon?
- Du wirst emotional robuster.
- Du reagierst bewusster statt impulsiv.
- Du gehst mit dir selbst freundlicher um.
- Und du findest neue Wege, mit Stress, Kritik oder inneren Konflikten klarzukommen.
Denn innere Freiheit beginnt dort, wo wir unsere inneren Schutzkräfte nicht mehr bekämpfen – sondern mit ihnen zusammenarbeiten.
FAZIT:
Jeder Mensch hat innere Schutzmechanismen. Manche helfen – andere blockieren. Was sie eigentlich wollen, wie man sie erkennt und verändert, zeigt dieser Artikel. Für mehr innere Klarheit und Gelassenheit. #Stress #Selbstregulation #Psychologie